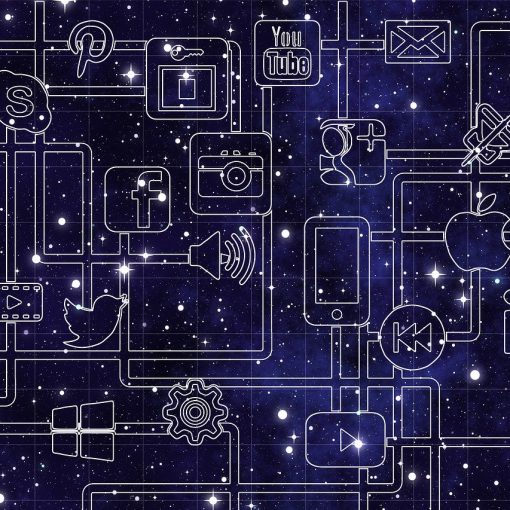Viele Bereiche der Hochschulen sind digitalisiert. Das ist erst der Anfang, sagen die Optimisten: Ein digitaler Campus. Auf dem digitalen Campus von morgen werden Forschung, Lehre und Verwaltung völlig neu gedacht. Wie realistisch sind solche Erwartungen? – Es folgt ein spannendes Gespräch zwischen F. Himpsl und A. Böckel, F. Denker, E. Kern und M. Wuppermann, welche sich mit dem digitalen Campus von morgen aussetzen. Lesen Sie über die Verpflechtungen von Lehre, Studieren und Technologien, aber auch welche Rolle diese einnehmen oder einnehmen sollten, im Zuge der digitalen Transformation einer Universität.
Öffnung von Hochschulen: Aber wie?
Mit der Digitalisierung der Hochschulen gehen viele Hoffnungen einher. Prozesse sollen schlanker werden, das Studium zugänglicher für unterschiedliche Personengruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Geht es nach dem Koalitionsvertrag der im Bund regierenden Parteien, sollen alle Studierenden bald Datenanalyse und grundlegende Programmierkenntnisse beherrschen.
Von einer Öffnung der Hochschulen ist die Rede und davon, dass an staatlichen Hochschulen auch Nano-Degrees erworben werden können. Der Begriff stammt eigentlich von der kommerziellen Online-Akademie Udacity; er meint thematisch gegliederte Einheiten, die vom Umfang her unterhalb eines regulären Abschlusses liegen.
Wie wäre es mit virtueller Mobiliät?
Passend dazu hat das Hochschulforum Digitalisierung in einem Thesenpapier die Flexibilierung und Individualisierung als Zielvorstellung ausgerufen – bis hin zur „virtuellen Mobilität“, durch die ein Studium an einer deutschen Hochschule möglich werde, ohne die ganze Studiendauer in Deutschland verbracht zu haben. Die große Vision dahinter: Der physische Ort soll irgendwann einmal keine Rolle mehr für die Qualität der Bildung spielen.
Digitaler Campus: Wie realistisch ist das?
Wie realistisch ist das? Richard Garrett, der Direktor des Observatory on Borderless Higher Education in London, schreibt in einem Beitrag für International Higher Education, er könne sich nur schwerlich vorstellen, dass es in Zukunft so etwas wie vollständige, auf reinem Online-Lernen basierende Abschlüsse für die Mehrheit der grundständig Studierenden geben werde. Das digitale Lernen gehe dafür nämlich mit zu vielen didaktischen Einschränkungen einher. Mit Blick auf die Studierendenmobilität ist Garrett überzeugt, dass Online-Lernen kein gleichwertiger Ersatz für das Reisen und Eintauchen in die realen Gegebenheiten vor Ort sei.
Nur 14% der Hochschulen haben eine Digitalstrategie
Die Kultusministerkonferenz hat Mitte März Empfehlungen zur Digitalisierung der Hochschullehre vorgelegt. Darin heißt es, es reiche nicht, die Digitalisierung „den Pionieren zu überlassen“. Sie müsse vielmehr „als fester Bestandteil der Hochschulentwicklung sowie der Hochschulstrategie bzw. des Hochschulprofils“ interpretiert werden.
Gewissermaßen als Kommentar dazu kann man das lesen, was die Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI) schreibt, die sich in ihrem Ende Februar verabschiedeten Jahresgutachten ebenfalls mit dem Thema beschäftigt hat. Laut einer Befragung im Auftrag der EFI haben derzeit nämlich lediglich 14 Prozent der Hochschulen eine Digitalisierungsstrategie.
Die Realität zeigt: Einige Hochschulen bewegen sich im Schneckentempo
Überhaupt zeigt der Realitätsabgleich, dass es mit der Digitalisierung an den Hochschulen eher zäh vorangeht. Umso wichtiger scheint es, denen zuzuhören, die von alledem unmittelbar betroffen sind – zum Beispiel den drei Studierenden, mit denen die DUZ Mitte März gesprochen hat.
Ein Wunsch eint sie mit unserem Gastautor Philipp Riederle: Die Hochschulen sollten ihre Mauern fallen lassen; sie sollten Lernmaterialien für alle zur Verfügung stellen. Und endlich anfangen, aus Sicht der Nutzer zu denken, also die sogenannte User Experience stärker miteinbeziehen. Eine Perspektive, die bei all den politischen Absichtsbekundungen rund um die Hochschuldigitalisierung gerne mal unter den Tisch fällt.
Ein Gespräch zwischen Expert:innen
Eigenbrötlerei, Ressourcenmangel, Plattformwirrwar: Bei der Digitalisierung steckt der Teufel oft im Detail. Alexa Böckel, Frederic Denker und Eva Kern gehören der Studierendengruppe „Digitale Changemaker“ an. Sie und Digitalisierungs-Experte Michael Wuppermann berichten im Gespräch mit der DUZ über ihre Alltagserfahrungen an deutschen Hochschulen.
Die wichtigsten Themen in einer Wortwolke

Herr Himpsl beginnt das Gespräch …
Frau Böcker, Herr Denker, Frau Kern, Sie sind Teil der Arbeitsgruppe „Digitale Changemaker“ des Hochschulforums Digitalisierung. Welche Veränderung wollen Sie bewirken?
BÖCKEL
Ich habe nach meinem Bachelorstudium ein halbes Jahr in der Verwaltung an der Leuphana in Lüneburg gearbeitet und kenne auch die Perspektive der studentischen Hilfskraft. Als meine Aufgabe sehe ich es an, meine Universität dahin zu bringen, mehr für die digitale Lehre zu tun.
Es geht aber nicht darum, mehr Beamer oder Laptops verfügbar zu haben. Mich beschäftigen eher Fragen wie: Wo speichern wir eigentlich unsere Daten? Dabei ist mir auch wichtig, von unseren Studierenden eine kritische Perspektive einzufordern und sie dazu zu befähigen.
Allgemein haben wir in der „Changemaker“-Gruppe des Hochschulforums Digitalisierung die Erfahrung gemacht, dass der Bedarf von Lehrenden,Verwaltungen und Universitäten, überhaupt mal mit Studierenden ins Gespräch zu kommen und ein Feedback zu dem zu bekommen, was sie tun, riesengroß ist.
Ein kleiner Tipp bevor Du weiterließt:
Durchsuch das Interview nach den Schlagwörtern, für die Du dich interessierst.
Einfach Shortcut eingeben: Windows: Strg + f macOS: ⌘ + f
KERN
Das Spannende an unserer Gruppe ist, dass wir Leute haben, die unterschiedlich weit sind: Bachelor, Master, Promotion. Wir tauschen uns über den Ist-Zustand, aber auch über unsere Wünsche in punkto Digitalisierung aus. Die Wenigsten von uns stehen übrigens auf dem Standpunkt „Technik,Technik, Technik“.
Ich selber versuche, ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in die Debatte zu bringen. Also nicht nur zu sagen: „Hey, wir sind superdigital.“ Sondern auch zu fragen: „Brauchen wir das alles?“ Denn manche neuen Technologien fressen viel Lebenszeit und viele Ressourcen.
DENKER
Ich komme von einer kleinen privaten Uni, der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Dort versuche ich, die Digitalisierung aus Studierendensicht zu begleiten.
Als „studentischer Digitalisierungsbeauftragter“ habe ich mir zusammen mit Kommilitonen mal genauer die Prozesse angeschaut. Dabei ist uns aufgefallen, dass vieles auf Eigeninitiative basiert.
Professoren sagen gerne: „Ich mache das jetzt einfach mal.“ Und auch wir Studenten werden gerne mal dazu aufgefordert, Lösungen selbst zu schaffen. Viele experimentieren im Kleinen herum, aber was fehlt, ist eine übergreifende Strategie, die Digitalisierung in all ihren Facetten abdeckt: die Inhalte, die Formate und die technische Struktur.
Herr Wuppermann, wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar: Sollen Hochschulen die Digitalisierung stärker in ihre Gesamtstrategie aufnehmen?
WUPPERMANN
Tatsächlich rufen gerade viele nach einer gesonderten Digitalstrategie für ihre Hochschule. Ich war bis vor einem Jahr auch der Meinung, dass das das richtige Mittel
sei. Mittlerweile bin ich der Ansicht, dass Digitalität ein zentraler Schwerpunkt jeder Hochschulentwicklung ist und sich dieser Schwerpunkt in der Gesamtstrategie und in den Hochschulentwicklungsplänen finden muss.
Dazu braucht es nicht unbedingt ein gesondertes Papier. Vielmehr benötigen wir einen Fahrplan im Sinne von Prioritäten, Zuständigkeiten, Fristen und Zielen. Digitalisierung ist kein Selbstzweck und nicht alles, was möglich ist, ist gut oder passt zu meiner Hochschule.
Was schlagen Sie stattdessen vor?
WUPPERMANN
Die Akteure in den Hochschulen zu stärken, die schon Initiativen vorantreiben und damit kleine Leuchttürme errichten. Es braucht ein Mindset und Commitment aufseiten der Hochschulleitung und entsprechende Ressourcen, zum Beispiel Serverkapazitäten, aber auch Knowhow und Kompetenzen bei den Mitarbeitenden.
Man sollte das alles nicht zu groß und kompliziert werden lassen, sondern stattdessen in die konkrete Umsetzung von Projekten und Maßnahmen gehen. Das Internet gibt es jetzt seit dreißig Jahren. Und doch empfinden wir vieles, was es mit sich bringt, immer wieder als vermeintlich noch nie dagewesen.
Nehmen Sie soziale Medien. Die Idee, dass sich Menschen in Netzwerken zusammenschließen und Informationen teilen, ist eigentlich nicht neu, nur der Modus, wie wir das tun, und die Möglichkeiten, mit denen auch Verantwortung einhergeht, haben sich geändert.
Ob wir es schaffen, mit solchen Technologien einen zielführenden Umgang zu finden, ist meist keine technische Frage.
BÖCKEL
Herr Wuppermann, Sie haben eben davon gesprochen, dass wir dafür sorgen sollten, die Eigeninitiativen zu stärken. Ich glaube, dass das mit dem Strategie-Gedanken vereinbar ist: Wir brauchen durchaus eine Strategie, aber eben keine, die top-down funktioniert.
Wichtig fände ich Anlaufstellen, die einen beraten, wenn man eine Idee hat, und im Zweifel auch mal bei der Drittmittel-Antragstellung helfen. In den Niederlanden ist es zum Beispiel üblich, dass an den Hochschulen in diesem Bereich im Rahmen von sogenannten Innovation Hubs eine Menge Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
KERN
Solche Anlaufstationen sind wichtig. Aber sie funktionieren nur, wenn sie wirklich sichtbar werden.
Unsere Studierenden haben so viele Ideen, das ist der Wahnsinn. Wieso schafft man da nicht einen wirklich präsenten Anlaufpunkt?
DENKER
Ich kann dem nur zustimmen. Bei der Strategie sollte es weniger darum gehen, irgendwelche Zielvorstellungen für die Gesamthochschule zu formulieren. Wichtiger wäre, einen Rahmen zu bieten: durch Beratung, durch eine gute Dokumentation, aber vielleicht auch einfach durch einen zentralen Server, auf dem selbstprogrammierte Skripte laufen können.
Aber Letzteres kann nur klappen, wenn man auch wirklich jedem am Anfang des Semesters sagt: Wenn du etwas langfristig etablieren willst, dann schiebe sie bitte immer dorthin.
Es geht also um Vereinheitlichung?
DENKER
Ja, aber auch um Kontinuität. Wir haben viele engagierte Studierende, die auch mal unkompliziert einen Code für ein Werkzeug schreiben. Aber irgendwann ist der Studierende weg, und dann ist die Gefahr groß, dass auch die Software nutzlos wird.
Es müsste Strukturen geben, die es ermöglichen, dass der Nächste, der kommt und eine solche Software weiterentwickeln möchte, unterstützt wird. Leuchttürme sind gut und schön, aber ohne solche Strukturen versinken sie irgendwann im Meer.
KERN
Wo wir schon beim Thema „bottom up“ sind: Warum nicht das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden? Ich finde, man sollte Studierende noch viel stärker bei der Entwicklung von digitalen Lerninhalten an Hochschulen mit einbeziehen.
Gerade dort, wo es technischen Studiengänge gibt. Ich als Informatik-Studentin habe ja auch viel mehr Lust, etwas zu programmieren, wenn ich weiß, dass das nicht in der Schublade landet.
Je jünger Menschen sind, desto digitalaffiner sind sie, lautet eine oft gehörte These. Stimmt das denn?
BÖCKEL
Natürlich kommt unsere Generation besser mit derBedienung eines Smartphones zurecht, schließlich sind die meisten von uns damit aufgewachsen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit Technologie allgemein einen souveräneren Umgang haben, im Gegenteil: Vielleicht sind da die Älteren sogar weiter, weil sie mit einer datenkritischeren Perspektive aufgewachsen sind.
KERN
Ich glaube, Digitalkompetenz ist eher eine Frage des Umfelds, in dem man aufwächst, als des Alters.
DENKER
Man sollte die digitale Kompetenz einer Personengruppe jedenfalls nicht daran festmachen, ob sie an die Nutzung sozialer Medien gewohnt ist. Nur weil jemand Snapchat verwendet, hat er noch keine Data Literacy, also die Fähigkeit, Daten zu analysieren und zu bewerten.
BÖCKEL
Wobei ich schon den Eindruck habe, dass das Alter Unterschiede macht. Ich bin jetzt im ersten Mastersemester; wenn ich mit Leuten spreche, die gerade erst ihren Bachelor angefangen haben, fällt mir auf: Die nutzen ganz andere Apps, und sie machen damit ganz andere Erfahrungen. Ich gehe zum Beispiel immer noch auf Facebook, wenn ich Veranstaltungen suche. Die Jüngeren sind da oft gar nicht mehr – und informieren sich stattdessen lieber auf Jodel.
Allgemein scheint ja die Zahl der Plattformen, auf denen Hochschulen unterwegs sein müssen, zuzunehmen. Einige haben zum Beispiel angefangen, sich mit ihren Studierenden per Whatsapp auszutauschen. Ist das ein Marketing-Gag, oder funktioniert das wirklich?
KERN
Ich persönlich nehme mir da lieber die halbe Stunde und spreche vor Ort mit einer Person, als mit jemandem zu chatten, bei dem ich gar nicht genau einschätzen kann, wer eigentlich dahinter steckt.
DENKER
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass solche neuen Formate mich ansprechen. Bei meiner Banking-App finde ich es ja auch angenehm, dass ich statt herkömmlicher E-Mails Push-Benachrichtigungen bekomme.
Man hat sich ans Aufploppen und Wegwischen mittlerweile schon gewöhnt. Warum sollten sich solche Gewohnheiten nicht auch Universitäten zunutze machen, die mit ihren Studierenden kommunizieren wollen?
BÖCKEL
Es kommt, glaube ich, immer auf die Inhalte an, dievermittelt werden sollen. Wenn ich einfach fragen möchte: Wann ist das Abgabedatum für meine Hausarbeit?, dann kann man das schnell auf Whatsapp klären.
KERN
Ich habe immer wieder mitbekommen, dass Studierende sich bei Gruppenarbeiten ausgeschlossen fühlten, weil die Gruppe sich über Whatsapp abstimmt, die betreffende Person aber eine andere Chat-App nutzt oder kein Smartphone hat. Deswegen finde ich es sinnvoll, die Angebote zu nutzen, die von den Hochschulen bereitgestellt werden.
Herr Wuppermann, Sie kennen die Perspektive der Universitäten. Sehen Sie es als Problem an, dass kommerzielle Lösungen amerikanischer Großkonzerne oft attraktiver und funktionaler sind als die Lösungen, die die Hochschulen selbst anbieten?
WUPPERMANN
Das kann man so nicht sagen, Hochschulen und Projekte haben zum Teil großartige Softwarelösungen für die besonderen Anforderungen ihrer Mitglieder programmiert. Wir beobachten aber immer wieder, dass eigeninitiativ Tools wie beispielsweise Slack eingesetzt werden, da sie im Vergleich zu E-Mails und Netzlaufwerken einen schnelleren Austausch mit mehr Information und Flexibilität bieten.
Doch dabei treten schnell Probleme auf, beispielsweise den Datenschutz betreffend. Daten liegen bei kommerziellen Anbietern meist in geschlossenen Systemen ohne geeignete Möglichkeiten, diese zu anderen Diensten umzuziehen, und für jedes Projekt und jede Aufgabe haben sie ein neues Tool mit anderen Zugangsdaten und Funktionsweisen. Das ist nicht zielführend und zufriedenstellend. Deshalb ist es wichtig, geeignete Lösungen für die sich ständig ändernden Anforderungen und technischen Möglichkeiten anzubieten.
BÖCKEL
Aus meiner Sicht ist das ein Problem, das deutschlandweit gelöst werden muss. Ich würde mir wünschen, dass die Politik an der Stelle Geld in die Hand nimmt und es den Hochschulen erleichtert, Dienste wie Mattermost zu nutzen.
Wir brauchen Open-Source-Lösungen, die auf den jeweiligen Hochschulservern gespeichert werden können, sodass die Datensicherheit gewährleistet ist. Und die zudem nutzerfreundlicher sind als Mystudy oder Moodle
WUPPERMANN
Vor diesen Problemen stehen Studierende genauso wie Wissenschaftler, etwa jene, die innerhalb von Forschungsverbünden mit Externen kommunizieren müssen. Die Zugänge sind zum Teil aus rechtlichen oder administrativen Gründen auf die eigenen Hochschulen begrenzt.
Aber oft fehlt es an den Workflows und der Verbindlichkeit der Partizipierenden untereinander, die sicherstellen, dass Tools auch tatsächlich genutzt werden. Denn was hilft es mir, wenn ich eine Anfrage in einem Messenger absetze und es kommt drei Tage lang keine Antwort?
Es geht also darum, alle dazu zu bringen, dieselben Anwendungen zu nutzen? Klingt nach einer Sisyphos-Arbeit.
KERN
Das Problem ist jedenfalls nicht, dass es keine Lösungen gäbe. Sondern eher, dass es zu viele gibt, zum Beispiel in der Lehre. Viele Dozenten haben nicht das technische Verständnis und auch schlicht nicht die Zeit, sich immer wieder in neue Lernplattformen einzuarbeiten. Es bräuchte aber auch eine Diskussion darüber, ob man Dozierende dazu verpflichten kann und soll, ganz bestimmte Plattformen zu nutzen.
BÖCKEL
Im Grunde genommen ist das ein klassisches Change-Management-Thema. Bei uns in der Arbeitsgruppe ist zum Beispiel kürzlich die Frage aufgetaucht: Wie kriegen wir alle dazu, das soziale Netzwerk zu nutzen, das wir aufgesetzt haben?
Letztlich hat man nur eine Chance, wenn man die Leute zwingt: Wenn eine Plattform die einzige ist, auf der man bestimmte wichtige Informationen erhält, bekommt man auch die Langsameren dazu, sie zu nutzen. Allerdings bin ich mir bewusst, dass so etwas für jüngere Leute, die es ohnehin gewohnt sind, sich dauernd bei neuen Diensten anzumelden, eine geringere Hürde darstellt.
KERN
Wobei das – und hier wären wir wieder beim Generationenthema – nicht nur eine Frage des Alters ist, sondern auch eine der Haltung zum Thema Datenschutz. Manche sind einfach weniger bereit, sich überall anzumelden.

Frau Böckel, Herr Denker, Frau Kern, Sie kommen mit der Digitalisierung regelmäßig als Seminar- oder Vorlesungsteilnehmer in Berührung. Wie fortschrittlich ist denn die Lehre an deutschen Hochschulen?
BÖCKEL
Ich habe zwei Bachelorstudiengänge absolviert und studiere jetzt im Master. Digitale Lehre hatte ich noch keine. Klar, es gibt Moodle, aber mein Verständnis von digitaler Lehre geht über die Möglichkeit hinaus, irgendwo PDF-Dateien herunterladen zu können.
Für mich würden echte Onlinevorlesungen dazugehören und Flipped Classrooms, bei denen man sich zu Hause die Inhalte im eigenen Tempo aneignet und sie dann in der Präsenzveranstaltung einübt. Dazu gehört auch, dass man mit Lehrenden und Mit-Lernenden auf anderen Kanälen als per E-Mail kommuniziert.
Ich hatte einen Philosophieprofessor, der brillante Vorlesungen aus dem Stand hielt, nur mit ein paar Notizen und einer Kreide bewaffnet. Jede Form von Technik hätte seine Vorträge eher schlechter gemacht …
BÖCKEL
Digitale Lehre bedeutet nicht immer bessere Lehre. Aber ich finde, wir haben da in einer demokratischen Gesellschaft auch eine gewisse Verpflichtung, unterschiedlichen Lernenden eine flexible Lernumgebung zu bieten.
Wenn der Philosophieprofessor keine Lernmaterialien hochlädt, ist diejenige, die aus persönlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann, auf die Mitschriften der anderen angewiesen.
KERN
Das schlimmste Szenario, das ich mir denken kann, ist: Der Lehrende ist mit den digitalen Medien einfach überfordert und kriegt deshalb auch nicht mehr die Inhalte hin.
Da habe ich doch lieber jemanden, der mir den Stoff kompetent auf dem Overhead-Projektor erklärt, als jemanden, der auf dem Smartboard herumspielt und bei den Inhalten unsicher ist, aber Hauptsache, es ist bunt und sieht cool aus, und ein Video haben wir auch noch gesehen.
Aber es gibt auch positive Beispiele. In einem Seminar haben Studierende meiner Hochschule einen Legostein mit RFID-Chips entwickelt, mit dem man wie bei „Wer wird Millionär?“ abstimmen konnte, und den haben wir dann in einem Seminar als Abstimmungs-Tool eingesetzt.
Da ist auch wirklich etwas hängengeblieben, weil man sich den Stoff anders als sonst angeeignet hat.
DENKER
Mit solchen Quiz habe ich auch gute Erfahrungen gesammelt. Ich bin ein großer Fan von „Kahoot!“. Man sitzt am Laptop und bekommt Fragen gestellt und für richtige Antworten bekommt man Punkte. Ich finde das unglaublich motivierend.
Spielen Online-Kurse in Ihrem Alltag eine Rolle?
BÖCKEL
Ich kenne niemanden, der an einem Massive Open Online Course – einem Mooc – teilgenommen und ihn dann auch abgeschlossen hat. Das finde ich schade, denn in dem Thema steckt enorm viel Potenzial, gerade für kleinere Hochschulen, die nur eine begrenzte Anzahl von Kursen bereitstellen können.
Studierende könnten so ihr Wissen vertiefen. Aber dazu müssten solche Moocs auch Teil des Curriculums und des Abschlusses sein. Denn wenn ich heute ein Zertifikat von Coursera bekomme, ist das gut und schön, aber was kann ich mir davon kaufen? Glaubt mir später irgendjemand, dass ich in dem Bereich qualifiziert bin?
DENKER
Es gibt in Deutschland vielleicht den einen Professor, der die beste BWL-Einführung gibt, der die Leute packt und mitnimmt. Warum zeichnet man seine Veranstaltungen nicht auf, sodass man auch an anderen Unis darauf zugreifen kann?
Wenn mich die Inhalte interessieren, die, sagen wir, an der Uni Konstanz gelehrt werden, muss ich schon jemanden kennen, der mir den Zugang verschafft. Das ist kein zufriedenstellender Zustand. Deshalb plädiere ich für eine nationale Bildungsplattform.
BÖCKEL
Dazu gehört dann aber auch, dass wir aufhören, die Universitäten dazu zu zwingen, Mauern um sich herum zu errichten. Aus gesellschaftlicher Sicht ist das wahnsinnig dumm. Ich würde mir wünschen, dass die Hochschulen Ressourcen für alle bereitstellen.
Aber auch, dass sie auf vielen Ebenen Qualitätssicherung betreiben; denn nicht alles, was sich heute zum Beispiel auf Youtube finden lässt, ist auch wissenschaftlich fundiert und auf dem Stand der Forschung. Von der Politik würde ich fordern, dass Moocs oberhalb einer gewissen Qualitäts-Grenze für Studium angerechnet werden dürfen.
WUPPERMANN
Im Transfer arbeiten wir klassischerweise in Formaten wie Konferenzen oder Workshops, die wir mit Tools digital erweitern oder durch neue Formate im Sinne kollaborativer Wissensproduktion zu Interaktion und Kollaboration anregen.
Das sind beispielsweise urheberrechtliche Aspekte, die die Digitalisierung von Veranstaltungen schnell komplex und ressourcenintensiv werden lassen. Das fängt schon an, wenn ich einen Livestream von einer Veranstaltung ins Netz stelle: Wie setze ich Widersprüche von Teilnehmern um?
Werfen wir einen Blick auf einen anderen Bereich, in dem die Digitalisierung etwas verändert hat – die Hochschulverwaltung. Ich hätte gerne Ihre Einschätzung als Studierende: Was funktioniert, was nicht?
BÖCKEL
An der Leuphana, wo ich studiere, läuft vieles ziemlich reibungslos: Die Prüfungsanmeldung ist digital, das Vorlesungsverzeichnis, die Notenvergabe.
Ärgerlich ist, dass man manche Anträge immer noch analog abgeben muss, innerhalb vorgegebener Sprechzeiten. Wenn ich krank bin, ist das ein Nachteil.
Das hat sicher auch etwas damit zu tun, dass digitale Unterschriften nicht akzeptiert werden, aber das ist vielleicht auch ein Problem, das eine einzelne Universität nicht lösen kann.
KERN
Ich habe vor zwölf Jahren angefangen, an der Hochschule Trier zu studieren. Schon damals konnte ich mich überall digital anmelden, ich habe keine Papierscheine mehr gesammelt.
Problematisch war aber das Thema Plattformen: Es gab unzählige davon, die man alle kennen musste, die aber nicht alle Dozenten in gleicher Weise genutzt haben. Ich weiß aber, dass mittlerweile versucht wird, das System zu vereinheitlichen.
DENKER
Ein großes Thema an meiner Universität ist das Transcript of Records, also die Übersicht der erbrachten Leistungen. Bislang muss das jemand aus der Verwaltung für jeden einzelnen Studierenden händisch in einem Word-Dokument zusammenbasteln.
Erstaunlich – zumal ich annehme, dass das Prüfungssystem selbst schon digitalisiert ist?
DENKER
Genau. Aber das Modulsystem ist so kompliziert und mit so vielen Regelungen verbunden, dass sich das daran anknüpfende Transcript offenbar schwer automatisieren lässt. Wenn man sich dann – wie ich vor Kurzem – für ein Auslandssemester bewirbt, werden auf einmal 150 Dokumente angefordert. Das Studienprüfungscenter muss dann sehr schnell Studienleistungen zusammenzählen, damit das dann rechtzeitig zum Auslandsamt weitergeleitet werden kann.
Herr Wuppermann, woran hakt es aus Ihrer Sicht noch bei der Digitalisierung der Verwaltung?
WUPPERMANN
Ich glaube, es gibt viele unterschiedliche und nicht bekannte Bedürfnisse der heterogenen Gruppen an den Hochschulen. Im Marketing spricht man von Customer Experience und Customer Journeys. Übertragen auf die Hochschule heißt das: Man betrachtet die Kontaktpunkte und Erwartungen der Gruppen in den einzelnen Phasen im Kontakt mit der Universität.
In dem Transfer-Projekt, in dem ich tätig bin, machen wir das beispielsweise, wenn es um Veranstaltungen geht. Die Vorgehensweise bietet sich aber für alle Bereiche der Hochschule an. So können wir die Erfordernisse der Nutzer besser berücksichtigen und Synergien schaffen.
KERN
Ich habe das Gefühl, der Informationsfluss scheitert oft nicht an technischen Problemen, sondern daran, dass sich niemand zuständig fühlt.
Das fängt schon bei E-Mails an: Wir haben eine Promovierendenvertretung und wollten den Austausch unter unseren Promovierenden befördern, aber uns war es nicht möglich, einen E-Mailverteiler einzurichten.
Die Dekanate und die Graduate School haben gegenseitig aufeinander verwiesen, daran ist das Vorhaben gescheitert. Vielleicht lag es auch ein Stück weit an berechtigten Datenschutz-Bedenken; trotzdem war das eine frustrierende Erfahrung.
Lassen Sie uns zum Schluss in die Zukunft schauen. Wie sieht Ihre Vision für die Hochschule des Jahres 2040 aus?
WUPPERMANN
Prognosen für die Zukunft sind schwierig, ich denke aber, dass Hochschulen gut aufgestellt sind, wenn sie Digitalisierung ganzheitlich denken, wenn sie Forschung, Lehre, Verwaltung und Transfer stärker verknüpfen und beispielsweise verstärkt Daten zur strategischen Steuerung nutzen.
Hochschulen sollten Räume fürs Experimentieren schaffen, digitale Kompetenzen fördern und sich Gedanken machen, wie sie bei ihren Mitgliedern ein digitales Mindset für die Veränderungen erreichen. Generell sollten Hochschulen ihre Ziele intern klar kommunizieren. Sie waren schon immer die Orte, wo Innovationen passieren. Darauf sollten sie auch in Zukunft vertrauen.
BÖCKEL
Die Flexibilisierung und Individualisierung, die überall in der Gesellschaft zu beobachten ist, sollte auch in der Hochschule abgebildet werden. Und das bezieht sich sowohl auf die physischen Lernräume als auch auf die digitalen.
Die Unis müssen darüber hinaus lernen, Datenschutzvorgaben einzuhalten und trotzdem die digitalen Möglichkeiten auszureizen.
KERN
Wenn die Digitalisierung nicht als Mehraufwand, sondern als Chance gesehen werden soll, braucht es die entsprechenden Ressourcen. Konkret braucht es Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von Ideen, vor allem aber mehr Vernetzung, zunächst einmal innerhalb der Hochschulen, und wenn wir das geschafft haben, dann auch zwischen den Hochschulen.
Wenn alle von der Digitalisierung profitieren sollen, ist mehr Transparenz nötig. Studierende, Lehrende, Verwaltung sollten sich an einen Tisch setzen und erst einmal untereinander klären, welche Bedarfe sie überhaupt haben. Und dann gemeinsam an Lösungen arbeiten.
DENKER
Mir sind zwei Aspekte wichtig. Zum einen: Wir brauchen noch mehr nationale Formate der Studenten-, aber auch der Professorenvernetzung.
Zum anderen: Neunzig Prozent der Dinge, die mich an der Uni stören, sind sehr banal – wie ein Stein im Schuh, der, obwohl er so klein ist, dann auf Dauer doch nervt. Das sind Probleme, die man ohne Weiteres lösen könnte, man muss einfach mit den richtigen Leuten sprechen.
Im Moment sind dafür die Hürden zu groß. Wenn wir es schaffen, dass die zuständigen Personen nicht mehr diese Abwehrreaktion zeigen – „Wieso beschwerst du dich denn über so eine Kleinigkeit?“ –, dann wären wir schon mal weiter.
Welche konkreten digitalen Kompetenzen brauchen Mitarbeiter:innen an Hochschulen?
Hier erfähren Sie mehr >>
Auszug aus dem Artikel „Wer Visionen hat“, geschrieben von Franz Himpsl, im Gespräch mit Alexa Böckel, Frederic Denker, Eva Kurz und Michael Wuppermann, sowie erstmals erschienen im DUZ Magazin 04/2019.